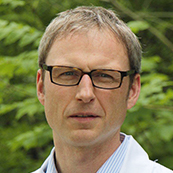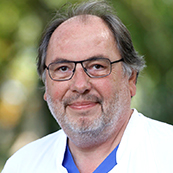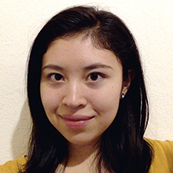Gerinnungsstörung bei COVID-19
Zusammenfassung
Neue Informationen über die Koagulopathie bei COVID-19 sind immer noch in Fluss, es gibt jedoch Hinweise darauf, dass thrombotische Gerinnungsstörungen in schweren Fällen recht häufig sind. Im Verglich zur konventionellen Sepsis-assoziierten DIC ist die Inzidenz der Thrombozytopenie bei COVID-19 relativ gering, während das D-Dimer deutlich höher ist. Im Vergleich zur hohen Inzidenz von thrombotischen Ereignissen sind Blutungskomplikationen bei COVID-19 sehr selten. Daher wird eine Standard-Antikoagulationstherapie dringend empfohlen werden.
New information about coagulopathy in COVID-19 is still in flow, but there is evidence that thrombotic coagulation disorders are quite common in severe cases. Compared to the conventional Sepsis-associated DIC is the incidence of thrombocytopenia in COVID-19 relatively low, while the D-dimer is significantly higher. Compared to the high incidence of thrombotic events, bleeding complications in COVID-19 is very rare. Therefore a standard anticoagulation therapy is strongly recommended.
Klinische Einsatzmöglichkeiten von Mesenchymalen Stromazellen
Zusammenfassung
Das therapeutische Potenzial von Mesenchymalen Stromazellen (MSC) wird in zahlreichen klinischen Studien geprüft. Die klinischen Einsatzmöglichkeiten für MSC sind breitgefächert und reichen vom Einsatz bei der Transplantatgegen-Empfänger Reaktion nach allogener Stammzelltransplantation bis zur Behandlung von chronischen Rückenschmerzen aufgrund von Bandscheibendegeneration. Im Jahr 2018 wurde die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen eines MSC-basierten Produktes zur Behandlung komplexer Fisteln bei Patienten mit Morbus Crohn durch die Europäische Arzneimittelbehörde erteilt. Diese Indikationen bei Erkrankungen mit sehr unterschiedlicher Pathophysiologie basieren auf den postulierten vielfältigen Wirkmechanismen der MSC, vor allem ihren parakrinen und durch Zell-Zell-Kontakt vermittelten Effekten, welche immunmodulatorisch und regenerationsfördernd wirken. Dieser Artikel stellt eine Übersicht zum therapeutischen Einsatz von MSC dar und nimmt darüber hinaus Bezug auf die Good Manufacturing Practice-konforme Herstellung von MSC. Aus aktuellem Anlass gehen wir auch auf Studien zu MSC bei COVID-19-Patienten ein.
The therapeutic potential of Mesenchymal Stromal Cells (MSC) is currently investigated in numerous clinical trials. MSC have a broad range of clinical applications, from therapeutic use in graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation to the healing of chronic low back pain due to disc degeneration. In 2018, the first marketing authorisation for an MSC-based product, indicated for treatment of complex fistulas in patients with Crohn's disease, was granted by the European Medicines Agency. These indications for MSC with different pathophysiology are based on the postulated multiple mechanisms of action of MSC, especially on their paracrine and cell-cell-contact effects which lead to immunomodulation and support regeneration. Here we review the therapeutic use of MSC and also touch on Good Manufacturing Practice conforming production of MSC. In the light of current events we also refer to studies of MSC for treatment of COVID-19.
Rekonvaleszentenplasma bei viralen Erkrankungen – eine Zwischenbilanz
Zusammenfassung
Für COVID-19 gibt es bisher keine zielgerichtete Therapie mit eindeutig belegter Wirksamkeit und wesentlicher, nachhaltiger Verbesserung des Verlaufs. Zugelassene Impfstoffe sind noch nicht verfügbar. Die passive Immunisierung durch Plasma von genesenen Patienten mit anti-SARS-CoV-2 Antikörpern im Plasma (Rekonvaleszentenplasma) ist eine der Therapieoptionen. Wir fassen den Wissensstand zu Rekonvaleszentenplasma bei anderen viralen Erkrankungen zusammen und ziehen eine Zwischenbilanz aus den bisherigen Studien bei COVID-19*: Plasma scheint auch in dieser Indikation sicher. Bisher gibt es vielversprechende Hinweise, jedoch keinen Nachweis einer Wirksamkeit von Rekonvaleszentenplasma. Dies ist im Wesentlichen durch das Fehlen von genügend Daten aus randomisierten kontrollierten Studien bedingt. Viele Fragen zu optimalen Spendermerkmalen, Dosierung und Zeitpunkt der Plasmagabe und den für diese Therapie geeigneten Patientengruppen sind offen. Wir fassen in diesem Beitrag die aktuelle Datenlage zusammen.*
So far no targeted therapy is available for treatment of COVID-19 which is proven to reduce complications and mortality. Vaccines are not approved yet. One treatment option for COVID-19 is passive immunization by administration of plamas from convalescent donors with anti-SARS-CoV-2 antibodies. We summarize the studies of convalescent plasma treatment for other acute viral infections and present an assessment of the available data on convalescent plasma for COVID-19: convalescent plasma appears to be safe. Data on efficacy are encouraging. However, the effect of convalescent plasma on mortality, time to improvement and safety is still very uncertain – mainly due to the lack of randomized controlled clinical trials. Many questions remain open, such as optimal donor characteristics, dose and time of convalescent plasma treatment and optimal selection of patients who might benefit from passive immunization. We will review currently available evidence.*
Ruhig Blut? Blutspenden in Zeiten von SARS-CoV-2
Leserfrage
Editorial
Transfusionsmedizin in den deutschen Feldlazaretten
Zusammenfassung
Die Blutung ist die häufigste Todesursache auf dem Gefechtsfeld und in vielleicht 15 % Fällen lassen sich Todesfälle mit Berücksichtigung und Optimierung der Prinzipien der Damage Control Resuscition und Damage Control Surgery vermeiden. Die massive Transfusion von Blutprodukten ist ein ganz entscheidender Faktor im Rahmen der „Damage Control Resuscitation“ und bestimmt ganz entscheidend die Überlebensrate der Gefechtsfeldopfer. Trotzdem muss es dem Kliniker vor Ort überlassen bleiben, den richtigen Zeitpunkt für die Initiierung eines „Massive Transfusion Protocols“ zu bestimmen da es durchaus Situationen geben kann (z. B. permissive Hypotension) die ein Zuwarten gerechtfertigt erscheinen lässt.
Bleeding is the most common cause of death on the battlefield and in perhaps 15 % cases, fatalities can be reduced by taking into account and optimizing the principles of "damage control resuscitation" and "damage control surgery". The massive transfusion of blood products is a very decisive factor in the context of "Damage Control Resuscitation" and is critical to the survival rate of battlefield casualties. However, it must be left to the clinicians on site to determine the appropriate time for the initiation of a "Massive Transfusion Protocol" as there may well be situations (e. g. permissive hypotension) which can cause that waiting seems justified.
Aktuell zur Diagnostik und Therapie der neonatalen Alloimmunthrombozytopenie
Neue Fortbildungsinhalte für die Fortbildung zur Qualifikation als Transfusionsverantwortlicher / Transfusionsbeauftragter / Leiter Blutdepot
Zusammenfassung
Einrichtungen der Krankenversorgung, die Blutprodukte anwenden, müssen nach § 15 des Transfusionsgesetzes die Funktion eines Transfusionsverantwortlichen (TV) und für jede Abteilung einen Transfusionsbeauftragten (TB) und falls ein Blutdepot vorhanden ist einen Leiter für das Blutdepots bestellen. Die entsprechende Qualifikation wird durch einen anerkannten 16 Stundenkurs erworben. Nach über 18 Jahren wurde das bisherige Curriculum überarbeitet und die Inhalte an die Gesamtnovelle 2017 der Richtlinie Hämotherapie angepasst. Das neue Mustercurriculum wurde am 18.1.2019 beschlossen und wird im Text vorgestellt. Nach Meinung der Autoren ist die Neuaufstellung der Themen gut gelungen und berücksichtigt mehr die praktischen Aspekte der Hämotherapie. Auch ist der Wegfall der Trennung in Teil A und B für eine flexiblere Kursgestaltung von Vorteil.
According to § 15 of the Transfusion Act, health care facilities that use blood products must appoint a person responsible for transfusions (TV) and a transfusion officer (TB) for each department and, if a blood depot is available, a head of the blood depot. The corresponding qualification is acquired through a recognised 16 hour course. After more than 18 years, the previous curriculum has been revised and the contents adapted to the 2017 amendment of the Hemotherapy Directive. The new sample curriculum was adopted on 18.01.2019 and is presented in the following text. In the opinion of the authors, the repositioning of the topics is well done and takes more account of the practical aspects of haemotherapy. Also the omission of the separation into part A and B is advantageous for a more flexible course design.
Chimäre Antigenrezeptor-exprimierende T-Zellen für die Krebsimmuntherapie
Zusammenfassung
Mittels Gentechnik können T-Zellen mit chimären Antigenrezeptoren (CARs) für effektive Tumor-Therapien neuausgerichtet werden. Hohe Raten vollständiger, wenngleich häufig transienter, Remissionen bei Patienten mit rezidivierten oder refraktären (r/r) akuten B-Zell-Leukämien (B-ALL) und B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen haben die klinische Wirksamkeit von antiCD19-CAR-T-Zell-Therapien eindrucksvoll bewiesen. Die Konditionierung der Patienten mittels lymphodepletierender Chemotherapie ist für CAR-TZell-Therapien eine wesentliche Voraussetzung. Schwere Nebenwirkungen der CAR-T-Zell-Therapie, wie das Zytokin-Freisetzungssyndrom, erfordern engmaschiges klinisches Monitoring, können aber durch frühzeitige Diagnose und Gabe von Tocilizumab effektiv therapiert werden. In der EU wurden 2018 gentechnisch modifizierte CD19-CAR-T-Zellprodukte (Kymriah/Yescarta) für die Therapie von Patienten mit mehrfach vorbehandeltem r/r juveniler B-ALL und gewissen B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen zugelassen.
Genetic engineering with chimeric antigen receptors (CARs) can redirect T cells for efficient tumor therapy. High rates of complete, albeit often transient remissions in patients with relapsed or refractory (r/r) acute B-cell leukemia (B-ALL) and B-cell Non-Hodgkin lymphoma impressively demonstrate the clinical benefit of anti-CD19-CAR-T-cell-therapies. Preconditioning with lymphodepleting chemotherapy is essential for CAR-T-cell-therapy to be efficacious. Severe adverse side effects, such as the cytokine release syndrome (CRS), require timely diagnosis but can be controlled by infusion of Tocilizumab. In 2018 the genetically engineered CD19-CAR-T-cells (Kymriah/ Yescarta) were licensed as third line therapy for juvenile r/r B-ALL and certain B-cell Non-Hodgkin lymphoma patients in the EU.
CAPSID-Studie: Eine randomisierte, prospektive, offene klinische Studie von Rekonvaleszentenplasma verglichen mit bestmöglicher supportiver Behandlung bei Patienten mit schwerem COVID-19
Erste Fälle der Übertragung von West-Nil- Virus-Infektionen durch Stechmücken in Deutschland und die daraus folgenden Konsequenzen für die Blutspende
Bringt das was?
Leserfragen
Editorial
Patient Blood Management: Ergebnisse der ersten internationalen Konsensus-Konferenz in Frankfurt 2018
Herstellung von Blutkomponenten aus Vollblutspenden aus der Perspektive großer Blutspendedienste
Zusammenfassung
In der modernen Medizin werden Bluttransfusionen nicht mehr direkt von Mensch zu Mensch durchgeführt. Heute sind wir in der Lage, den Patienten Blutkomponenten gezielt je nach Indikationsstellung zu transfundieren. Vollblutspenden freiwilliger Spender werden dazu in speziell ausgestatteten Blut-Manufakturen in ihre Bestandteile, Erythrozytenkonzentrate und Plasma, aufgetrennt. Zusätzlich werden aus den Restzellen, den sog. Buffy Coats, Pool-Thrombozytenkonzentrate aus jeweils mehreren Spenden hergestellt. Alle notwendigen Schritte werden in geschlossenen Kunststoffbeutelsystemen, die an keiner Stelle im Prozess eröffnet werden, abgebildet. Die Sterilität der resultierenden Blut-Medikamente ist damit gewährleistet. Dieser Artikel beschreibt die einzelnen Prozesse der Blutkomponentenherstellung aus der Perspektive der großen Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes und geht auf die zunehmende Einführung von automatisierten Arbeitsschritten und neue Entwicklungen ein.
Blood transfusion in modern medicine is no longer performed directly from human to human. Nowadays we are able to specifically apply blood components to patients according to given transfusion indications. For this purpose, whole blood donations from voluntary donors are separated into their components, red blood cell concentrates and plasma, in specially equipped bloodmanufactories. In addition, pooled platelets are produced from so called buffy coats comprising residual cells from several donors. All necessary steps take place in closed synthetic bag-systems, which are never opened at any point during the process. Consequently, sterility of the resulting blood-medications is guaranteed. This article depicts the manufacturing processes of blood components from the perspective of the large German Red Cross blood donation services and addresses the increasing implementation of automation and new developments in the field.
Einhundert Jahre Frauenmilchbanken – ein neues Betätigungsfeld für Blutspendedienste
Zusammenfassung
Seit April werden im DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen im Institut Frankfurt Frauenmilchspenden zu pasteurisierten Frauenmilchportionen weiterverarbeitet. Auch wenn Frauenmilch rechtlich gesehen ein Lebensmittel ist, können zahlreiche Strategien aus der Transfusionsmedizin sinnvoll auch auf Frauenmilch angewandt werden. Mit der im Rahmen einer Kooperation mit der Neonatologie des Universitätsklinikums Frankfurt etablierten Frauenmilchbank trägt der Blutspendedienst dazu bei, eine wichtige Versorgungslücke für die allerkleinsten Patienten zu schließen und stellt erstmals ein Lebensmittel her.
Since April 2019, the German Red Cross Blood Donation Services Baden-Württemberg – Hessen produces pasteurized human breast milk from breast milk donations. Although human breast milk is subject to the German Food Act, some strategies derived from transfusion medicine were used to set up a human breast milk bank. Our cooperation between the Department of Neonatology, University Hospital Frankfurt/Main and the Blood Donation Service allows us close a health gap and to support preterm infants with urgently needed human breast milk.
Kaltlagerung von Thrombozyten: Aktuelle Herausforderungen und zukünftige Perspektiven
Zusammenfassung
Thrombozyten spielen die Schlüsselrolle in der primären Hämostase, daher ist die Thrombozyten(konzentrat)-Transfusion, besonders im Fall von schweren Blutungen, essentiell. Die ersten Versuche Thrombozyten zu lagern erfolgten bei +4 °C. Aufgrund der eingeschränkten Funktionalität wurde jedoch bald die Lagerung bei +22 °C favorisiert. In den letzten Jahren hat sich jedoch die Lagerung von Thrombozyten auf Grund der mehr und mehr eingesetzten Additivlösung als Lagermedium deutlich gewandelt. Durch die Lagerung in Additivlösung scheint die Lagerbarkeit bei +4 °C günstig beeinflusst. Thrombozyten zeigen deutlich weniger Lagerungsschäden und die Lagerungsdauer lässt sich deutlich verlängern, ohne das Risiko für ein bakterielles Keimwachstum zu erhöhen.
Platelets play the key role in primary hemostasis, the transfusion of platelet concentrates is therefore essential in case of bleeding. Initially platelet concentrates were stored at +4 °C. Because of better platelet function and viability, platelet concentrates stored at +22 °C were soon favored compared to platelet concentrates stored at +4 °C. In recent years it has become more and more common to store platelets in additive solution. Additive solutions seem to be suitable for storage of platelets at +4 °C with comparable platelet function and properties compared to storage at +22 °C. Platelets have less storage lesions and an extension of the storage time seems possible without increasing the risk of bacterial contamination.
Qualitätssicherung Hämotherapie in Hessen
Heparin-induzierte Thrombozytopenie: von der bakteriellen Abwehr zu einem neuen Mechanismus der Autoimmunität.
Zusammenfassung
Die Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT) ist eine unerwünschte Arzneimittelwirkung, bei der das endogene Chemokin Plättchenfaktor 4 (PF4) an Polyanionen bindet, dabei seine Konformation verändert und eine Immunreaktion auslöst. Die Immunreaktion gegen PF4/Polyanionen-Komplexe führt zu einem ganzen Spektrum von Antikörpern mit unterschiedlicher biologischer Relevanz. Die meisten Antikörper lassen sich in einem Enzym Immunoassay nachweisen, führen aber weder zur Thrombozytenaktivierung noch zu klinischen Problemen. Eine deutlich seltener auftretende Subgruppe dieser Antikörper aktiviert Thrombozyten und kann klinisch die vermehrte Produktion von Thrombin induzieren über eine Aktivierung von Thrombozyten, Monozyten und Endothelzellen. Noch viel seltener sind Anti-PF4/Polyanionen-Antikörper, die als Autoantikörper auftreten und ohne Zugabe von Heparin oder anderen Polyanionen schwere klinische Komplikationen auslösen können. Der vorliegende Beitrag fasst die immunologischen und biophysikalischen Experimente zusammen, mit denen die molekularen Mechanismen aufgeklärt wurden, wie es dazu kommen kann, dass ein endogenes (körpereigenes) Protein Antikörper induziert und welche Charakteristika diese Antikörper haben, wenn sie zu einer Autoimmunerkrankung führen. Es ist wahrscheinlich, dass ähnliche Mechanismen auch für Autoimmunreaktionen gegen andere Proteine des Körpers verantwortlich sind.
Heparin-induced thrombocytopenia (aHIT) is an adverse drug effect. The endogenous chemokine platelet factor 4 (PF4) binds to polyanions. Hereby PF4 is changing its confirmation and triggers an immune reaction. The immune reaction against PF4/polyanion complexes results in a large spectrum of antibodies with variable biological relevance. Most of these antibodies are reactive in enzyme immunoassays but do not cause platelet activation and no clinical complications. About 20 to 50 % of these antibodies activate platelets in vitro in the presence of heparin. In vivo, these antibodies together with heparin cause activation of platelets, monocytes and endothelial cells. This results in increased generation of thrombin and an increased risk for thrombotic complications. Much rarer are anti-PF4/polyanion antibodies, which react as autoantibodies and activate platelets and induce thrombotic complications without addition of heparin or other polyanions. They are causing autoimmune HIT. This review summarizes the immunological and biophysical experiments used to unravel the molecular mechanisms of autoimmune HIT. It shows how an endogenous (body’s own) protein can induce antibodies and describes the characteristics of these antibodies required for induction of an autoimmune disease. It is highly likely that similar mechanisms are also responsible for other antibody mediated autoimmune diseases.