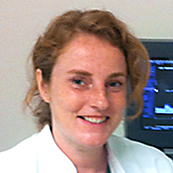Autoren der Hämotherapie
Die Ärzte und wissenschaftlichen Mitarbeiter aus allen Blutspendediensten des Deutschen Roten Kreuzes tragen mit ihren Artikeln regelmäßig zum Fachmagazin hämotherapie bei.
Hier finden Sie alle Informationen zu den Autoren und ihre Beiträge.
Infoblatt für Autoren
Möchten Sie als Autor für die hämotherapie aktiv werden?

Facharzt für Transfusionsmedizin
Abteilungsleiter am Institut für Transfusionsmedizin und
Immunhämatologie Frankfurt, DRK-Blutspendedienst
Baden-Württemberg – Hessen gemeinnützige GmbH
Dr. med. Markus M. Müller ist Facharzt für Transfusionsmedizin mit der Zusatzbezeichnung Hämostaseologie und als Oberarzt und Abteilungsleiter am Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie in Frankfurt am Main beschäftigt. Nach dem Studium der Humanmedizin und Promotion an der Universität Ulm im Fachbereich Innere Medizin – Hämostaseologie / Hämatologie und internistische Onkologie begann er seine klinische Ausbildung in der Inneren Medizin mit den Schwerpunkten Hämostaseologie und Hämatologie an der Universitätsklinik Ulm unter Prof. Dr. med. Hermann Heimpel. Er wechselte dann als Projektleiter für klinische Forschung zu einem global tätigen forschenden Arzneimittelunternehmen und leitete dort zwei Forschungsbereiche. Von 2001 bis Ende 2019 war er am Institut in Frankfurt beschäftigt. Von 2011 bis 2020 leitete er als Oberarzt die Abteilung Blutentnahme am Institut Frankfurt. Das Fortbildungs- und Schulungsangebot „Transfusionsmedizin“ für externe Kliniken wurde von ihm aufgebaut und geleitet. Als leitender Arzt war er auch für die immunhämatologische Diagnostik und die Blutdepots an externen Kliniken verantwortlich sowie als Qualitätsbeauftragter Hämotherapie und externer Transfusionsverantwortlicher tätig. Er war Studienleiter einer Langzeitstudie zur Sicherheit freiwilliger gesunder Stammzellspender, beschäftigt sich wissenschaftlich mit Methoden zur Pathogeninaktivierung von Blutpräparaten und publiziert zusammen mit Kollegen Buchbeiträge und wissenschaftliche Übersichtsarbeiten auf den Gebieten der Hämostaseologie und der Transfusionsmedizin. In den letzten Jahren sind die klinische Transfusionsmedizin und das Patient Blood Management (PBM) Forschungsschwerpunkte von Dr. Müller. Von 2020 bis 2023 leitete Dr. Müller als Ärztlicher Direktor und Institutsdirektor das Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (ITM) in Kassel des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen. Seit 2023 ist er als Oberarzt und Abteilungsleiter Blutspende am Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie in Frankfurt am Main beschäftigt.
Beiträge
Kapitel 1: Erythrozytenkonzentrate
Zusammenfassung
Nach nunmehr zwölf Jahren seit der letzten Gesamtnovelle der QuerschnittsLeitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten (QLL) liegt seit dem 21.8.2020 eine aktuelle Gesamtnovelle der QLL vor. Während die Datenlage aus großen, randomisierten und prospektiven Studien im Jahr 2008 noch sehr dünn war, hat sich hier in der letzten Dekade vor dem Hintergrund des Patient Blood Managements (PBM) eine Vielzahl von Studien angesammelt, die nun für eine Reihe von Indikationsstellungen belastbare Daten liefern. Dabei wurden die restriktiven Hämoglobin(Hb)-Transfusionstrigger interessanterweise nicht weiter abgesenkt, sondern liegen nun im Schnitt etwa 1 g/dl höher, zumeist bei 7 g/dl.
After 12 years since the last overall amendment of the cross-sectional guidelines for the therapy with blood components and plasma derivatives (CSG), a current overall innovation of the CSG is available since 21.8.2020. While data from large, randomized and prospective studies was scant in 2008, a large number of studies has accumulated in the last decade against the background of Patient Blood Management (PBM), which now provide reliable data for a number of indications. Interestingly, the restrictive hemoglobin (Hb) transfusion triggers were not lowered further, but are now on average about 1 g/dl higher, mostly at 7 g/dl.
Neues aus der Rubrik „Was tun wir bei …?“
Zusammenfassung
Die Bestrahlung zellulärer Blutprodukte, also vor allem von Erythrozytenkonzentraten (EK) und Thrombozytenkonzentraten (TK), mit 30 Gray dient der Prophylaxe einer Transfusions-assoziierten Graft-versus-Host-Erkrankung (ta-GvHD) bei immuninkompetenten Transfusionsempfängern. Wenn diese Transfusionsnebenwirkung auch auf Einzelfälle beschränkt ist, so ist ihr letaler Ausgang doch Grund genug, diese einfach Prophylaxe vor Transfusion durchzuführen. Die Querschnitts-Leitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten der Bundesärztekammer führen die Indikationen zur Bestrahlung zellulärer Blutkomponenten detailliert auf. Allerdings ergeben sich in der praktischen Umsetzung der Leitlinien-Inhalte immer wieder Fragen und Probleme, die der vorliegende Beitrag adressiert. So ist unter anderem die Logistik bestrahlter Blutpräparate, die für einen individuellen Patienten auf Anforderung hergestellt werden, für einige kleinere Krankenhäuser problembeladen. Auch der Zeitraum, über welchen zelluläre Blutpräparate bei den einzelnen Erkrankungen bestrahlt werden sollten, ist für einzelne Indikationen in manchen Häusern nicht oder nicht korrekt festgelegt. Schließlich führen auch die Querschnitts-Leitlinien Krankheitsentitäten auf, bei denen die Evidenz für oder gegen eine Bestrahlung zellulärer Blutpräparate nicht ausreichend ist. Hier muss lokal entschieden werden. Die Autoren stellen die Bestrahlungsindikationen ihres Universitätsklinikums als ein mögliches Beispiel vor, wie die genannten Fragen beantwortet werden können. Diese Bestrahlungsindikationen wurden 2009 durch eine Expertengruppe des Universitätsklinikums Frankfurt erarbeitet und im Dezember 2009 durch die Transfusionskommission verabschiedet. Es ist wichtig, die jeweiligen Bedingungen „vor Ort“ zu berücksichtigen.
Irradiation of cellular blood components, mainly packed red blood cell concentrates (RBC) and platelet concentrates (PC), using γ irradiation with 30 Gy, prevents transfusion-associated Graft-versus-Host Disease (ta-GvHD) in severely immunocompromised recipients. Even if extremely rare, the fatal outcome of ta-GvD makes it mandatory to perform this easy form of prophylaxis. The cross-sectional guidelines for therapy with blood components and plasma derivatives by the German Medical Association specify indications for irradiation of cellular blood components in detail. However, in daily work, questions and problems often arise when one tries to implement the guidelines in a specific hospital. This article tries to answer some of the frequently asked questions. The logistics of irradiated blood components, produced for an individual recipient on request, is problematic for some smaller hospitals. In addition, the time span for treatment with irradiated cellular blood components in specific courses of disease or specific groups of patients is not always or not always correctly defined. The cross-sectional guidelines finally list a number of diseases, for which there is not enough evidence to decide pro or contra irradiation of cellular blood components. Here, a local decision is mandatory. The authors present the irradiation indications of their university hospital as a potential idea, how to answer these questions. These indications were developed by a group of physicians at the Frankfurt university hospital in 2009. The transfusion commission accepted these indications in December 2009. The local situation has always to be taken into account.
Hämorrhagische Diathesen - Teil 2
Zusammenfassung
Während im ersten Teil dieser Übersicht (hämotherapie 9/2007; pp. 13-31) die Einteilung der Blutungsneigung in Thrombozytopenien bzw. Thrombozytopathien, Koagulopathien und Vaskulopathien im Vordergrund stand, sollen in diesem zweiten Teil an den klinisch wichtigen Beispielen der disseminierten intravasalen Gerinnung (DIC) und der erworbenen Hemmkörper-Hämophilie diagnostische und therapeutische Strategien im Umgang mit blutenden Patienten diskutiert werden. Bei angeborenen hämorrhagischen Diathesen wie den Hämophilien A oder B ist anamnestisch meist die Blutungsneigung vorbekannt. Im Gegensatz hierzu werden bei den in dieser Übersicht diskutierten, erworbenen Formen häufig sowohl Patient und Angehörige, als auch medizinisches Personal von der Blutungsneigung überrascht, die mit einer bis dato leeren Eigen- und Familien-Anamnese hinsichtlich Hämorrhagien einhergeht. Es ist wichtig, schnell zur korrekten Diagnose zu kommen und eine zielgerichtete Behandlung einzuleiten, deren langfristiger Erfolg unter anderem auch von der Zeit bis zum Behandlungsbeginn abhängt. Eine kontinuierliche klinische und labordiagnostische Überwachung der eingeleiteten Maßnahmen macht nicht nur eine an den einzelnen Patienten angepasste „Therapie nach Maß“ möglich, sondern bestätigt bei Erfolg der eingeleiteten Maßnahmen auch die zu Anfang korrekt getroffene Verdachtsdiagnose. Zum Abschluss dieser Übersicht werden Literatur und Kontakte aufgeführt, die bei Interesse an den diskutierten Fragestellungen weiterführen.
In the fi rst part of this overview (hämotherapie 9/2007; pp. 13-31), we focused on the classifi cation of bleeding disorders in thrombocytopenia/ impaired platelet function, coagulopathy and vasculopathy. This second part discusses diagnostic and therapeutic strategies for bleeding patients using the two clinically relevant examples for acquired bleeding disorders, disseminated intravascular coagulation (DIC) and acquired haemophilia with inhibitors. While patients with hereditary bleeding disorders like haemophilia A or B usually have a history of bleeding episodes, patients, family members and medical staff are often caught off guard, when bleeding occurs due to acquired bleeding disorders, where personal and family history are both negative. A quick initial tentative diagnosis and a rapid, purposeful start of therapeutic interventions are mandatory for a positive outcome. Successful treatment of these disorders is amongst others a matter of “time to treatment”. Continuous clinical and laboratory monitoring not only offers the benefi t of treatment tailored to the individual patient, but if successful, also corroborates the initial tentative diagnosis. This second part of our overview also includes suggestions for further reading and information on how to contact scientifi c groups in the fi eld of haemostasis.
Hämorrhagische Diathesen - Eine Übersicht
Zusammenfassung
Hämorrhagische Diathesen, angeborene (hereditäre) oder erworbene Gerinnungsstörungen mit erhöhter Blutungsneigung, sind definiert als das Auftreten von spontanen Blutungen oder Blutungen ohne adäquates vorangegangenes Trauma. Es können dabei auch verstärkte oder verlängerte Blutungen, beispielsweise perioperativ bzw. verstärkte oder verlängerte Menstruationsblutungen auftreten, wohingegen die normale Menstruationsblutung als spontane aber physiologische Blutung von der Definition einer hämorrhagischen Diathese ausgenommen ist. Die drei wichtigen Elemente des Hämostasesystems sind a.) die Thrombozyten, b.) das plasmatische Gerinnungs- und Fibrinolyse-System mit den dazugehörigen Inhibitoren und c.) die Gefäßwände. Eine physiologische Blutstillung bei Verletzungen der Gefäßintegrität, aber auch die Verhinderung einer überschiessenden Gerinnungsaktivierung, wird durch die fein austarierte Balance und das Zusammenspiel aller drei beteiligten Subsysteme gewährleistet. Im Rahmen einer erhöhten Blutungsneigung ist deshalb die Differenzierung in Störungen der Thrombozyten-Zahl (Thrombozytopenie) oder -Funktion (Thrombozytopathie), Störungen der plasmatischen Gerinnung (Koagulopathie) bzw. in Störungen des Gefäßsystems wichtig. Ebenfalls wichtig ist die Unterscheidung zwischen angeborenen und erworbenen Blutungsneigungen mittels Anamnese: Erstere treten häufig lebenslang mit zeitlich wechselndem klinischem Schweregrad auf, sind genetisch verankert und können oft auch mit Hilfe einer positiven Familienanamnese diagnostiziert werden. Bei den erworbenen Blutungsneigungen, welche primär oder sekundär im Rahmen von Grunderkrankungen auftreten, berichten die Patienten über eine vorherige normale Blutstillung. Mit der Behandlung der Grundkrankheit können diese erworbenen Hämostasestörungen wieder zurückgehen. Darüber hinaus ist hierbei die Familienanamnese regelhaft leer. Die strukturierte Anamnese hat eine herausragende Bedeutung für die Diagnostik der hämorrhagischen Diathesen. Im Rahmen der Anamnese ist bei solchen Blutungspatienten eine ausführliche Medikamentenanamnese von besonderer Bedeutung. Diese Übersicht kann nicht alle Aspekte einer hämorrhagischen Diathese eingehend beleuchten. Wir beschränken uns daher nach einer allgemeinen Einführung auf eine kurze Diskussion der Thrombozytopenien und -pathien, Koagulopathien sowie Vaskulopathien, erläutern im zweiten Teil dieser Übersicht im nächsten Heft dieser Zeitschrift am klinischen Beispiel der disseminierten intravasalen Gerinnung (DIC) und der erworbenen HemmkörperHämophilie die diagnostische und therapeutische Strategie im Umgang mit blutenden Patienten und wollen zum Schluss weiterführende Literatur und Kontakte zum Thema vermitteln.
Bleeding disorders, either hereditary or acquired, are defined as the occurrence of spontaneous bleeding or bleeding without adequate reason (trauma, surgery, etc.). Prolonged or intensive bleeding episodes can occur perioperatively or during heavier or prolonged menstrual bleedings, menorrhagia. However, normal physiological menstruation, although spontaneous, is not included in the definition above. Key elements of the haemostatic system are a.) platelets, b.) the plasmatic coagulation and fibrinolytic system including their inhibitors and c.) the vascular system. Physiological haemostasis in case of vascular injury as well as inhibition of an overwhelming activation of the coagulation system is only possible by a dynamic balance and a close cooperation of all the key elements mentioned above. In patients with bleeding disorders, it is therefore essential to distinguish between low platelet count (thrombocytopenia), functional platelet defects (thrombocytopathy), disorders of the plasmatic coagulation and fibrinolytic system (coagulopathy) or diseases affecting blood vessels (vasculopathy). The medical history including family history helps to differentiate between hereditary and acquired bleeding disorders. The former disorders are genetically based, may occur lifelong with variable symptoms and are often associated with a positive family history. Acquired bleeding disorders can occur in healthy subjects, but mainly occur in patients with severe underlying diseases, who did not bleed inappropriately before. Typically, the family history in such cases is negative and the bleeding disorder often vanishes with successful treatment of the underlying disease. The patient´s history is vital in the diagnostic algorithm of bleeding disorders. The patient´s drug history is a key element in the history. This overview cannot present all aspects of bleeding disorders. After an introduction, we limit this overview to a short discussion of disorders associated with thrombocytopenia, impaired platelet function, coagulopathy or vasculopathy. In the second part of this overview, which will be published in the next issue of this journal, we discuss a possible diagnostic and therapeutic approach for bleeding patients using the clinical examples of disseminated intravascular coagulation (DIC) and acquired hemophilia with inhibitors. Finally, this overview will include suggestions for futher reading and potential contacts to scientifi c groups in this fi eld.
Buch-Rezensionen
Leitlinien der Bundesärztekammer:
Herstellung von Blutkomponenten aus Vollblutspenden aus der Perspektive großer Blutspendedienste
Zusammenfassung
In der modernen Medizin werden Bluttransfusionen nicht mehr direkt von Mensch zu Mensch durchgeführt. Heute sind wir in der Lage, den Patienten Blutkomponenten gezielt je nach Indikationsstellung zu transfundieren. Vollblutspenden freiwilliger Spender werden dazu in speziell ausgestatteten Blut-Manufakturen in ihre Bestandteile, Erythrozytenkonzentrate und Plasma, aufgetrennt. Zusätzlich werden aus den Restzellen, den sog. Buffy Coats, Pool-Thrombozytenkonzentrate aus jeweils mehreren Spenden hergestellt. Alle notwendigen Schritte werden in geschlossenen Kunststoffbeutelsystemen, die an keiner Stelle im Prozess eröffnet werden, abgebildet. Die Sterilität der resultierenden Blut-Medikamente ist damit gewährleistet. Dieser Artikel beschreibt die einzelnen Prozesse der Blutkomponentenherstellung aus der Perspektive der großen Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes und geht auf die zunehmende Einführung von automatisierten Arbeitsschritten und neue Entwicklungen ein.
Blood transfusion in modern medicine is no longer performed directly from human to human. Nowadays we are able to specifically apply blood components to patients according to given transfusion indications. For this purpose, whole blood donations from voluntary donors are separated into their components, red blood cell concentrates and plasma, in specially equipped bloodmanufactories. In addition, pooled platelets are produced from so called buffy coats comprising residual cells from several donors. All necessary steps take place in closed synthetic bag-systems, which are never opened at any point during the process. Consequently, sterility of the resulting blood-medications is guaranteed. This article depicts the manufacturing processes of blood components from the perspective of the large German Red Cross blood donation services and addresses the increasing implementation of automation and new developments in the field.
Bericht vom internationalen Expertentreffen der Weltgesundheitsorganisation zu „emerging infections“ und Blutsicherheit
Zusammenfassung
Mitte Juni 2017 trafen sich auf Einladung der Weltgesundheitsorganisation 28 Experten aus aller Welt für zwei Tage in Genf in der WHO-Zentrale, um einen Überblick über die Lage der (wieder) neu auftretenden Infektionskrankheiten (Englisch: (re-)emerging infectious diseases; kurz: EID) und deren Einfluss auf die weltweite Blutversorgung zu geben. Besonderer Wert wurde dabei auf diejenigen Voraussetzungen gelegt, die weltweit für die Risikoeinschätzung und das Risikomanagement beim Auftreten einer solchen globalen Bedrohung notwendig sind. Neben Berichten zu den einzelnen EID-Ausbrüchen der vergangenen Jahre sowie dem diagnostischen und therapeutischen Vorgehen auf den verschiedenen Kontinenten lag ein Schwerpunkt auf den aus den bisherigen EID-Ausbrüchen gemachten Erfahrungen und deren Nutzen für zukünftige Krisen. Es wurden mehrere unterschiedliche, Internet-basierte Unterstützungsprogramme vorgestellt, die im Vorfeld bzw. bei Auftreten eines EID-Ausbruchs nationale Entscheidungsträger bei der risikobasierten Entscheidungsfindung zum Schutz der Blutversorgung unterstützen können. Dazu diskutierten die versammelten Mikrobiologen, Virologen, Epidemiologen, Transfusionsmediziner, Biomathematiker und Statistiker mit Vertretern der nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden.
The World Health Organisation (WHO) invited 28 technical experts from all over the world for a two-day global consultation at the WHO headquarters in Geneva from June 14 to June 15, 2017. The topic of this consultation was to give an assessment of the impact of newly or re-emerging infectious diseases (EID) on global blood supply. Influences and requirements for risk estimation and decision making support were the principal discussion topics here. After several reports of different EID outbreaks occurring within the recent years and discussion of the diagnostic and therapeutic approaches on all continents, the experts shared common experiences from these outbreaks and benefits for future occurrences. Several different computer and internetbased supportive programmes were presented assisting national responsible experts in their risk based decision making for blood safety. Microbiologists, virologists, epidemiologists, transfusion medicine specialists, biomathematicians and statisticians discussed these topics during the WHO global technical expert consultation with national and international regulators.
Patient Blood Management Studie: Sicherheit und Effizienz eines Patient Blood Management (PBM)-Programm
Zusammenfassung
Die Transfusion von Blutkomponenten und Blutprodukten birgt trotz ihrer - in vielen Fällen - unbestreitbar lebensrettenden Funktion nach wie vor auch Risiken. Daher sind die kritische und bestmögliche Indikationsstellung, sowie verschiedene Techniken und Ansätze zur Vermeidung von Bluttransfusionen Gegenstand aktueller Forschung. Noch ist die Datenlage dazu jedoch dünn. In der von Markus Müller et al. vorgestellten multizentrischen Studie sollen daher umfassende Daten zur Sicherheit und Effizienz eines Patient Blood Management (PBM) Programms erhoben werden.
Aside from its life saving potential, blood transfusion still bears risks. Therefore, optimal use of blood and various techniques and approaches to avoid blood transfusion are hot topics. However, data still are scant. The multi-center study, initiated by Markus Müller et al., is intended to collect comprehensive data on the safety and efficacy of a Patient Blood Management (PBM) programme.
Alle Ausgaben
durchsuchen
Können Sie immer hier
am Seitenende.