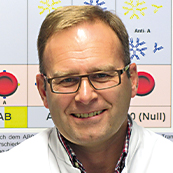Malaria-Antikörperscreening im Blutspendedienst – Ein neuer Ansatz zur Versorgung von Patienten mit seltenen Blutgruppen
Zusammenfassung
Seit September 2024 wird im DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen und im DRK-Blutspendedienst Nord-Ost neben anamnestischen Methoden auch ein Screening auf Malariaplasmodien-spezifische Antikörper durchgeführt. Das Verfahren steht in Übereinstimmung mit der aktuellen Hämotherapie-Richtlinie. Im ersten Jahr konnten insgesamt 13.200 Spender auf eine zurückliegende Malariainfektion untersucht werden. Die Positivrate (initial reaktive Proben) lag bei 1,62 % und hat dazu beigetragen, dass zum einen die Versorgung der Krankenhäuser mit Blutprodukten verbessert werden konnte, zum anderen auch Erythozytenkonzentrate mit seltenen Blutgruppenmerkmalen charakterisiert und bereitgestellt werden konnten. Damit sind der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen und der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost gut vorbereitet auf sich ändernde klinische Anforderungen, die durch nicht europäischstämmige Patienten bestehen. Die Sicherheit der Blutprodukte hat dabei weiterhin höchste Priorität.
Since September 2024, the German Red Cross Blood Donation Service in Baden-Württemberg and Hessen and the German Red Cross Blood Donation Service in North-East Germany have been Screening for malaria plasmodium-specific antibodies in addition to using anamnestic methods. The procedure complies with the current hemotherapy guidelines. In the first year, a total of 13,200 donors were tested for past malaria infection. The positive rate (initially reactive samples) was 1.62 %, which helped to improve the supply of blood products to hospitals and also enabled erythrocyte concentrates with rare blood group characteristics to be characterized and made available. This means that the German Red Cross Blood Donation Service Baden-Württemberg – Hessen and the German Red Cross Blood Donation Service North-East Germany are well prepared for changing clinical requirements arising from patients of non-European origin. The safety of blood products remains the top priority.
Immunthrombozytopenie (ITP) – Neue Therapieoptionen
Zusammenfassung
Die Immunthrombozytopenie (ITP) ist mit 2–4 Neuerkrankungen auf 100.000 Einwohner und Jahr eine seltene Erkrankung. Da es keinen ITP-beweisenden Labortest gibt, beruht die Diagnose der Erkrankung vornehmlich auf dem Ausschluss anderer Ursachen für die Thrombozytopenie. Die Entscheidung für eine Therapie sollte nicht allein auf der verminderten Thrombozytenzahl beruhen, sondern auch das individuelle Blutungsrisiko der Patientinnen und Patienten berücksichtigen. Die Standard-Erstlinientherapie ist immer noch die Gabe von Kortikosteroiden. In diesem Beitrag behandeln wir die Pathophysiologie und Diagnose der ITP und geben Hinweise zur Behandlung der ITP, die sich an der aktuellen Onkopedia-Leitlinie orientieren.
Immune thrombocytopenia (ITP) is a rare disease with 2–4 new cases per 100,000 inhabitants per year. As there is no laboratory test to prove ITP, the diagnosis of the disease is primarily based on the exclusion of other causes of thrombocytopenia. The decision for treatment should not be based solely on the reduced platelet count, but should also take into account the patient's individual risk of bleeding. The standard first-line therapy is still the administration of corticosteroids. In this article, we discuss the pathophysiology and diagnosis of ITP and provide information on the treatment of ITP based on the current Onkopedia guideline.
Third-Generation-Sequencing: Chancen für die Transfusionsmedizin
Zusammenfassung
Third-Generation-Sequencing (TGS) eröffnet neue Perspektiven für die molekulargenetische Diagnostik in der Transfusionsmedizin. Im Vergleich zu klassischen serologischen und molekulargenetischen Technologien ermöglicht TGS eine genauere Blutgruppen- und HLA-Typisierung sowie die Identifizierung komplexer Haplotypen und struktureller Varianten. In der Pathogendetektion erlaubt TGS perspektivisch eine umfassende, weitgehend biasfreie Analyse mikrobieller Genome und die verbesserte Rückverfolgung transfusionsassoziierter Infektionen mit spannenden Anwendungsfällen im Bereich der Resilienz gegenüber Pandemien und Bioterrorismus. Dieser Beitrag skizziert TGS als zukunftsweisende Plattformtechnologie, erläutert Funktionsweise, Vorteile, Limitationen und zentrale Herausforderungen.
Third-generation-sequencing (TGS) opens new perspectives for molecular genetic diagnostics in transfusion medicine. Compared to classical serological and molecular genetic technologies, TGS enables more accurate blood group and HLA typing as well as the identification of complex haplotypes and structural variants. In pathogen detection, TGS offers the potential for comprehensive, mostly bias-free analysis of microbial genomes and improved tracing of transfusion-associated infections, with exciting applications in the context of resilience to pandemics and bioterrorism. This article outlines TGS as a forward-looking platform technology, highlighting its mechanisms, advantages, limitations, and key challenges.
Die Leukapherese als immunologisches Ausgangsprodukt der CAR-T-Zelltherapie im Kontext zunehmender Indikationen und steigender Nachfrage
Zusammenfassung
Die CAR-T-Zelltherapie wird zunehmend in unterschiedlichen Indikationsgebieten eingesetzt. Das Leukapheresematerial hat dabei nicht nur eine technische, sondern auch eine immunologische Relevanz für Wirksamkeit, Toxizität und Persistenz. Studien zeigen, dass Alter, Vortherapien und der Zeitpunkt der Zellgewinnung die Funktionalität der T-Zellen beeinflussen. Einzelzelltechnologien ermöglichen eine detaillierte Charakterisierung des Ausgangsmaterials. Klinisch etablierte Marker wie niedrige CD3+-Zellzahlen oder eine kürzliche Bendamustin-Exposition sind mit ungünstigeren Verläufen assoziiert. Die Apherese sollte daher auch unter diagnostischen Gesichtspunkten betrachtet werden. Akademische Zentren mit eigener CAR-T-Herstellung können hierbei strukturierte Beiträge leisten.
CAR-T cell therapy is being applied across an increasing range of indications. Leukapheresis material is relevant not only technically but also immunologically, influencing efficacy, toxicity, and persistence. Studies indicate that patient age, prior treatments, and collection timing affect T-cell function. Single-cell technologies allow detailed characterization of the starting material. Established clinical markers, such as low CD3+ T-cell counts or recent bendamustine exposure, are associated with less favorable outcomes. Leukapheresis should therefore also be assessed diagnostically. Academic centers with in-house CAR-T manufacturing can contribute to structured implementation.
Quantifizierung von ATP in Erythrozytenkonzentraten
Zusammenfassung
Die Qualitätssicherung von Erythrozytenkonzentraten (EK) über ihre Haltbarkeit von bis zu 42 Tagen ist essenziell für die klinische Versorgung. Ein zentraler Funktionsparameter ist der intrazelluläre Adenosintriphosphat-(ATP)-Gehalt als Marker für metabolische Aktivität und strukturelle Integrität. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) fordert ATP als verpflichtenden Vitalitätsparameter bei Zulassungsuntersuchungen. Der Wegfall des etablierten ATP-Hexokinase-Kits von DiaSys erfordert einen geeigneten Ersatz – besonders im Hinblick auf DEHP-freie Beutelsysteme. In Kooperation mit Promega wurde ein luminometrischer ATP-Assay erfolgreich implementiert. Dieser Artikel beleuchtet die regulatorischen Anforderungen, die klinische Relevanz und praktische Aspekte bei der Einführung des neuen Verfahrens zur ATP-Bestimmung.
The quality assurance of erythrocyte concentrates (EC) over their shelf life of up to 42 days is essential for clinical care. A key functional parameter is the intracellular adenosine triphosphate (ATP) content as a marker for metabolic activity and structural integrity. The Paul Ehrlich Institute (PEI) requires ATP as a mandatory vitality parameter in approval tests. The discontinuation of the established ATP hexokinase kit from Diasys requires a suitable replacement – especially with regard to DEHP-free bag systems. In cooperation with Promega, a luminometric ATP assay was successfully validated and implemented. This article highlights the regulatory requirements, clinical relevance, and practical aspects of introducing the new ATP Determination method.