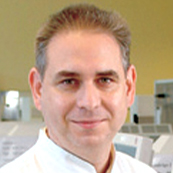Autologe Serumaugentropfen
Zusammenfassung
Neben industriell hergestellten künstlichen Tränenersatzmitteln werden seit etwa Anfang der 90er Jahre des zurückliegenden Jahrhunderts Patienten mit schweren Hornhautdefekten oder chronisch trockenem Auge mit großem Erfolg mit autologen Serum-Augentropfen behandelt (ASA). Der Therapieeffekt ist auf die im Serum vorhandenen epitheliotrophen Substanzen wie epithelial growth factor (EGF), platelet-derived growth factor (PDGF), Fibronektin und andere zurückzuführen. Seit einigen Jahren können ASA GMP-gerecht unter Wahrung arzneimittelrechtlicher und pharmazeutischer Standards im geschlossenen System hergestellt werden. Da die Nichtunterlegenheit von ASA gegenüber industriell hergestellten Tränenersatzmitteln bisher nicht eindeutig belegt ist, sind die Kostenträger nur schwer zu einer Kostenübernahme zu bewegen. Zudem gibt es bisher kein standardisiertes Herstellungsverfahren mit Blick auf Verdünnung, Lagerdauer und -temperatur. Dies sowie der schwierige Nachweis objektivierbarer Therapieerfolge wie Rückgang von Schmerzen und Fremdkörpergefühl schränkt die Verfügbarkeit dieser Präparate weiterhin deutlich ein, obwohl sie gut verträglich sind und subjektiv spürbare Besserung der Symptomatik erwarten lassen.
Apart from industrially produced artificial tears, patients with severe corneal defects or chronic dry eye syndrome have been treated with great success with autologous serum eye-drops (ASE) since the early 1990s. The therapeutic effect is based on epitheliotrophic substances present in the serum such as epithelial growth factor (EGF), platelet-derived growth factor (PDGF), Fibronektin and others. For some years now, ASE can be produced in a closed system according to GMP-guidelines under adherence to drug law and pharmaceutical standards. Since the non-inferiority of ASE compared with industrially produced artificial tears could not be proved yet, health insurance providers are reluctant to bear the cost. Nevertheless, there is still no standardized production protocol with regard to dilution, storage length and storage temperature. Furthermore the lack of measurable therapeutic effects such as abating pain and reduced foreign body sensation significantly restricts the use of these preparations though they are well-tolerated and a subjective and perceptible improvement of the symptomology can be expected.
Mutspende 2015
Blutdepots in Einrichtungen der Krankenversorgung – Rechtskonforme Organisation und qualitätsgesicherter Betrieb
Zusammenfassung
Blutdepots in Krankenhäusern spielen bei der sicheren Versorgung von Patienten mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten eine wichtige Rolle. Um die qualitätsgesicherte Führung von Blutdepots sicher zu stellen, sind eine Reihe von Anforderungen an die Beschaffung, Lagerung und Ausgabe der Arzneimittel zu berücksichtigen. Die entsprechenden Anforderungen werden in diversen regulatorischen Vorgaben adressiert. Interne Audits und die Aufsicht durch die Behörden sollen die Umsetzung sicherstellen und überprüfen.
Blood depots in hospitals play an important role in the secure supply of patients with blood products and plasma derivatives. To guarantee the quality of procurement, storage and dispensing of the blood products, various regulatory standards define rules. Internal audits and supervision by public authorities are tools to examine and promote the implementation of standards.
ÜBER DEN TELLERRAND GESCHAUT: Blutbank in Haiti mit deutscher Unterstützung neu aufgebaut
Screening von Thrombozytenkonzentraten auf bakterielle Kontaminationen: Diagnostische Methoden und aktuelle Entwicklungen
Zusammenfassung
Die Übertragung von bakteriellen Infektionen durch Transfusion von Thrombozytenkonzentraten (TKs) stellt trotz vielfältiger Maßnahmen (restriktive Spenderauswahl, verbesserte Hautdesinfektion, Verwurf der ersten Milliliter Vollblut) nach wie vor ein ungelöstes Problem in der Transfusionsmedizin dar. Da septische Komplikationen in Zusammenhang mit TKs besonders mit älteren Produkten beobachtet wurden, ist die Haltbarkeit von TKs im Jahr 2008 von 5 auf 4 Tage reduziert worden. Durch bakterielle Screening-Methoden kann sowohl die Blutproduktesicherheit erhöht als auch die Lagerungsdauer wieder auf die ursprünglichen 5 Tage verlängert werden. Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über die aktuellen diagnostischen Methoden für das Bakterienscreening von TKs sowie deren Anwendung im Routinelabor.
Transfusion-transmitted bacterial infection by platelet concentrates (PCs) remains an unresolved problem despite the implementation of several measures including improved donor selection, skin disinfection methods and the diversion of the first milliliters of whole blood. Since platelet-related septic complications have been observed particularly with older PCs the shelf life of PCs was reduced in 2008 from 5 to 4 days. Using bacterial screening methods can increase blood product safety and extend the storage period back to 5 days. This article gives an overview of the current diagnostic methods for bacterial screening of PCs and their applicability in a routine setting.
Lohfert-Preis 2014 geht an das „Patient Blood Management“- Programm am Universitätsklinikum Frankfurt
NEUES AUS DER RUBRIK „Was tun wir bei...?“ Dokumentation bei der maschinellen Autotransfusion (MAT)
Wer kennt Benin? Oder : über die Entwicklungszusammenarbeit des Bayerischen Roten Kreuzes / Blutspendedienst mit dem Centre Départemental de Transfusion Sanguine in Parakou, Benin
Zusammenfassung
Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes hat 1987 in Parakou im Zentrum Benins eine Blutbank aufgebaut, die durch Anfangsinvestitionen und Know-how-Transfer eine dem nationalen Niveau angepasste Versorgung mit sicheren Blutprodukten gewährleistet. Über eine alljährliche Evaluierung mit Beratung und persönlicher Unterstützung vor Ort durch die BRK-Delegierte und Mitarbeiterin des BRK-Blutspendedienstes, Ute Wohlfart, wird die Weiterentwicklung des Blutspende- und Transfusionswesens in Benin unterstützt. Ihr hier vorliegender Beitrag schildert die Entwicklung und den derzeitigen Stand der Blutbank in Parakou und liefert darüber hinaus eindrucksvolle Fakten zur Landessituation und zum Gesundheitssystem in Benin.
In 1987 the blood transfusion service of the Bavarian Red Cross established a blood bank at Parakou in Benin. With the help of a start-up investment and the transfer of know-how it is capable of ensuring the supply of blood products according to national standards. By annual evaluation, mentoring and on-site support Ute Wohlfart, Red Cross delegate and member of staff of its blood transfusion service, promotes the advancement of Benin’s blood donation and transfusion system. In her article she relates the development and the actual state of the blood bank at Parakou and, in addition to that, provides striking facts concerning the state of affairs and the health care system of the country.